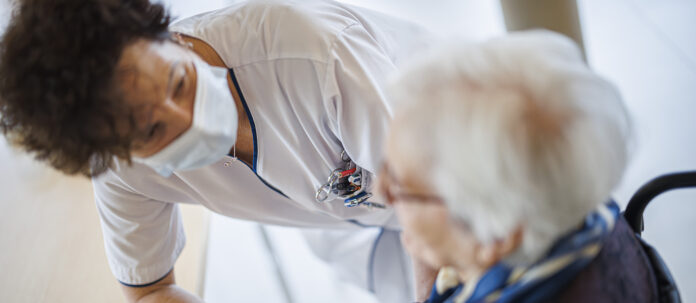
Die Volksanwaltschaft hat in Alten- und Pflegeheimen Mängel bei Schmerzmanagement und Palliativversorgung festgestellt. Bei einer Schwerpunktprüfung sei aufgefallen, dass es in einem Viertel der Einrichtungen kein systematisches, dokumentiertes Schmerzmanagement gibt. Unwissenheit beim Personal herrsche rund um das Thema assistierter Suizid, erklärten Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) und Pflegeexpertin Esther Kirchberger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.
„Wir wissen, dass 80 Prozent der Menschen in dem Alter Schmerzen haben“, sagte Achitz. Heutzutage sei die Schmerzversorgung aber so gut, dass sich diese in vielen Fällen vermeiden ließen, das verlange auch die Europäische Charta der Patientenrechte. Bei einer Schwerpunktprüfung hat die Volksanwaltschaft 123 Einrichtungen in allen Bundesländern besucht und mit 1.511 Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen oder deren Dokumentationen gesichtet, Achitz sprach von „präventiver Menschenrechtskontrolle“.
Lesen Sie auch
Die notwendigen Schritte im Schmerzmanagement – Screening, Assessment, Behandlungsplan, Verlaufskontrolle und Evaluation – würden in zahlreichen Einrichtungen nur zum Teil durchgeführt, stellten Achitz und Kirchberger, die Mitglied einer Kommission der Volksanwaltschaft ist, fest. Ein Screening gebe es etwa nur in 59 Prozent der Einrichtungen, einen Behandlungsplan in 50 Prozent, eine Evaluation in 47 Prozent. Noch schlechter sehe die Situation bei Menschen aus, die aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen wie Demenz nicht mehr äußern können, ob sie Schmerzen haben. Bei diesen könne man etwa biografische Daten zurückgreifen, sagte Kirchberger. Ein standardisiertes Schmerzmanagement müsse jedenfalls integraler Bestandteil der Betreuung in Pflegeeinrichtungen sein, fordert die Volksanwaltschaft.
Zudem brauche es u.a. regelmäßige Schulungen im Schmerzmanagement. Die Volksanwaltschaft empfiehlt außerdem, personenunabhängige Suchtmittelnotfalldepots per Gesetz zu erlauben. Diese würden Notfallmedikamente beinhalten, die verhindern könnten, dass Bewohner ins Spital gebracht werden oder dass mit ihrer Behandlung gewartet werden muss, bis ein Arzt verfügbar ist.
Schon seit 2004 gebe es ein Projekt, um Heimmitarbeiter in Palliativversorgung zu schulen, fast 20 Jahre später habe man allerdings nur in 20 Prozent der Einrichtungen geschulte Mitarbeiter vorgefunden. Als Gründe für die Verzögerung würden etwa die Corona-Pandemie oder der Personalmangel in der Pflege genannt – „darunter leidet die Palliativversorgung“, sagte Achitz. In über der Hälfte der Einrichtungen habe es nicht genügend Personal gegeben.
Auch beim Thema assistierter Suizid ist die Volksanwaltschaft auf Probleme gestoßen. Beim Personal herrsche hier große Unwissenheit, sagte Kirchberger. Achitz berichtete von „einer Handvoll“ kirchlicher Einrichtungen, in denen im Heimvertrag festgehalten ist, dass dieser gekündigt werde, wenn ein Bewohner nach einem assistierten Suizid fragt oder diesen verfolgt. Die Palliativmedizin müsse ausgebaut werden, um die Notwendigkeit hintanzuhalten, Menschen, die ausdrücklich nach assistiertem Suizid fragen, müssten aber aufgeklärt werden. Seitens des Trägers solle es jedenfalls Handlungsanleitungen geben bzw. Position dazu bezogen werden, wie mit dem Thema umgegangen wird.

